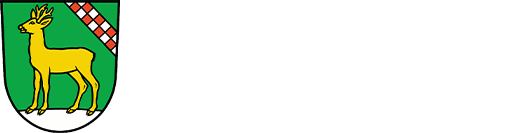Gegründet am 25. Mai 2012 und eingetragen in das Vereinsregister am 13. August 2012 ist die „Geschichtswerkstatt Rehfelde e.V." einer der jüngsten Vereine der Gemeinde. Er zählt gegenwärtig fast 20 Mitglieder. Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche Person und jede juristische Person werden, die die Ziele des Vereins unterstützt.
Der Verein ist gemeinnützig und hat sich gemäß seiner Satzung der Förderung
- von Wissenschaft und Forschung,
- von Kunst und Kultur,
- der Heimatpflege und Heimatkunde und
- der Erziehung, Volks- und Berufsbildung verschrieben.
Konkret hat sich der Verein die Aufgabe gestellt, die Geschichte Rehfeldes
- wissenschaftlich zu erforschen und darzustellen,
- die gewonnenen Forschungsergebnisse öffentlich zu machen,
- bei der Erhaltung und Pflege der geschichtlichen Zeugnisse und des traditionellen Brauchtums der Gemeinde fachliche Beratung zu gewähren.
Mitglieder des Vereins, darunter eine ausgewiesene Historikerin, recherchieren schon seit fast 15 Jahren in Archiven und Bibliotheken, betreiben Oral History, archäologische Erkundungen und Fachdiskussionen, alles mit dem Ziel, eine umfassende Geschichte Rehfeldes von der Eiszeit bis 1989 zu erarbeiten.
Die Arbeit soll 2013 fertig gestellt und publiziert werden. Da die Herausgabe des Bandes allerdings die finanziellen Möglichkeiten des Vereins übersteigt, ist er auf Verständnis und Hilfe bei der Aufbringung eines Druckkostenzuschusses angewiesen. Spenden sind daher sehr willkommen - Sparkasse Märkisch-Oderland, BLZ 170 540 40, Konto-Nr. 200 193 43